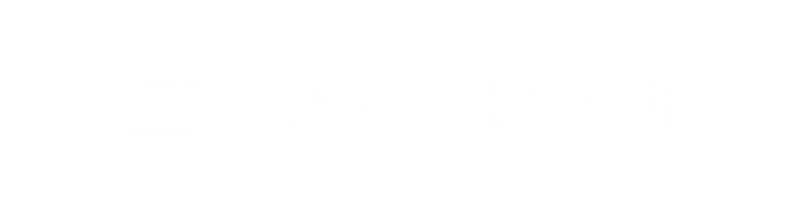Ein Beitrag von Alina Senger
“Du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein”. So lauten die prognostizierenden Worte Klaus Schwabs, der sich sehnlichst eine gleichgeschaltete und nihilistische Welt wünscht, in der Privateigentum einer frevelhaften Vergangenheit angehört. Eine utopistische Idee, die sich nun auch in den Köpfen der Kleinsten der Gesellschaft verewigen soll.
Das Gedicht “Meins oder Deins” für Grundschüler der vierten Klasse ist ein Sinnbild marxistisch geprägter Unterrichtsformen. Agitatorisch wird den Kindern in dem Gedicht übermittelt, wie friedvoll die Welt doch wäre, wenn niemand mehr irgendetwas besitzen würde. Wenn jegliche Besitztümer in einer gemeinschaftlichen Masse verschwinden würden. Doch was bedeutet es eigentlich für ein Kind, etwas eigenes zu besitzen? Es erfüllt ein Kind mit Stolz. Endlich ist es ein Stückchen näher an den eindrucksvollen Erwachsenen. Selbstbewusst und voller Freude zeigt ein Kind seine eigene Errungenschaft. Es erzählt mit leuchtenden Augen, wie unfassbar spannend sein Besitz ist. Oft wird auch der kleine Forscher in ihm geweckt, der eine brennende Leidenschaft entwickelt. Jedes Kind hat das Bedürfnis, etwas nur für sich zu haben. Auch ein Stück weit, um abseits der Masse eine eigene Identität zu entwickeln und sich abzugrenzen. Gleichwohl geht es jedem erwachsenen Menschen, der teils bewusst und teils unbewusst durch Habseligkeiten seine Persönlichkeit ausdrückt. Oftmals bergen diese unterschiedlichste Geschichten. Verrückte Lebensphasen, die in trauter Gesellschaft unter schallendem Gelächter erzählt werden. Nostalgische Kindheitserinnerungen, die man immer wieder mal in einer ruhigen Minute in die Gegenwart zurückholt. Mitbringsel aus fremden Ländern, Geschenke von nahestehenden Personen oder vielleicht auch Dinge, die über einige Generationen weitervererbt wurden und Teil einer einzigartigen Familienbiografie darstellen.
Ebenso kommen mir bei diesem Thema Kinder der Jugendhilfe in den Sinn. Insbesondere Kinder der stationären Jugendhilfe, die ihr Leben lang etliche Beziehungsabbrüche und fehlende emotionale sowie körperliche Nähe hinnehmen müssen. Sie müssen sich in der Regel mit zehn anderen Kindern die Sozialpädagogen teilen, die inoffiziell die Ersatzeltern darstellen. Sie müssen einen Großteil der Spielsachen teilen, um die auch gerne kräftig gestritten werden. Süßigkeiten sowie die guten Plätze vor dem Fernseher müssen geteilt werden und vieles, vieles mehr. Nun haben sie ein paar wenige Besitztümer, die in der Regel auch einen sehr hohen emotionalen Wert haben und die mit allen Mitteln vor Fremdbenutzung beschützt werden müssen, weil sie nunmal nur diese paar Kleinigkeiten im Leben haben, die nur ihnen gehören. Selbstverständlich ist es wichtig Kindern das Teilen und die Bedürfnisse anderer nahezubringen, um sie nicht zu kleinen Egomanen und später zu ausgereiften Narzissten werden zu lassen. Doch kann es nicht der richtige Weg sein, Kindern jegliche Besitztümer wegzunehmen oder ihnen erst gar keine zu gestatten, um angeblich mögliche Ungerechtigkeiten zu vermeiden. Man zwingt sie zu einem Verhalten, das ihnen von Natur aus widerstrebt.
Denn was bringen wir ihnen denn eigentlich damit bei? Gewiss nicht, wie man seine Grenzen und die der anderen respektiert. Eher lehren wir den Kindern damit, sich gegen ihre Überzeugungen zu fügen. Sich zu etwas drängen zu lassen, weil eine hartnäckige Gruppe das gerne so möchte. Eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung kann erst dann vollzogen werden, wenn ein Mensch in der Lage ist, eigenständig Entscheidungen zu treffen. Für die Ausbildung eines starken und unabhängigen Ich-Bewusstseins benötigt er die Kompetenz, Entschlüsse abzuwägen und gegebenenfalls zu verwerfen. Dieser wichtige Abschnitt der Persönlichkeitsentwicklung wird den Kindern in einer sozialistischen Utopie jedoch verwehrt, da jegliche Entscheidungen über die Verwendung von persönlichem Eigentum sowie die zusätzlichen Identifikationsmöglichkeiten hinfällig werden.
Doch das grundlegende Problem beim sozialistischen Gedankengut ist die Ausblendung der realen Gesellschaft. Sie wird nicht vom Standpunkt der ihr drohenden Gefahren gemessen, sondern vom Standpunkt einer utopischen Verheißung. So verflüchtigt sich die inhärente Destruktivität zwar aus der offiziellen Theorie, jedoch nicht aus der politischen Umsetzung, was sie umso gefährlicher macht. Durch zusätzliches Emotionalisieren der Doktrin und dem Aufbau eines Gutmenschentums, entrückt man sie einer sachlich-kritischen Auseinandersetzung. Das Thema Inklusionsklassen ist ein anschauliches Beispiel sozialistischer Experimente, die sich in der Theorie ganz wunderbar und philanthropisch anhören, jedoch in der Realität zu vielschichtigen Problemen führen. Grundlegend überforderte Lehrer, die in ihrem Studium zu kleinen Wissenschaftlern ausgebildet werden, erwarten bei Antritt ihrer Berufslaufbahn wissbegierige Lernmaschinen in den Klassen. Konfrontiert werden sie aber vielmehr mit verhaltensauffälligen Kindern aus schwierigen Familiensystemen. Es herrscht ein angespanntes Klima der Hierarchie, des Konkurrenzkampfs und der Aggression. Ungestüme Emotionen von Kindern können von
vielen Lehrkräften weder richtig gedeutet noch adäquat aufgefangen werden. Meist sind sie
selbst derart überreizt und ausgelaugt, dass sogar ein Viertel von ihnen unter Burnout-Symptomen leiden.
Und was bedeutet das als Konsequenz für die Schüler? Sie haben kaum noch eine Chance, vollständig in ihrer Individualität und mit all ihren Stärken und Schwächen wahrgenommen zu werden. Ihre spezifischen Potenziale gehen in den stoischen Leistungsanforderungen und fehlendem Fachwissen über psychologische Mechanismen seitens der Lehrer einfach unter. Nun sollen Lehrkräfte und Schüler noch zusätzlich mit geistig eingeschränkten Menschen, die einen speziellen Lehrstoff und besonderen Umgang benötigen, ihren Schulalltag meistern. Normal entwickelte Kinder klagen über furchtbar langweilige Unterrichtsthemen, über die Benachteiligungen und das Übersehen ihrerseits. Neid, Ablehnung und fehlende Empathie machen sich breit. Tägliche Konflikte, die lautstark verbal oder häufig auch körperlich ausgetragen werden, nehmen zu. Und auch an dieser Stelle soll gesagt sein, dass eine offene und wohlwollende Haltung gegenüber Behinderungen aller Art, Kindern nähergebracht werden muss. Jedoch nicht in einer derart unvorbereiteten, einengenden und aufgezwungenen Art und Weise.
Obwohl bereits dutzende sozialistische Regime scheiterten und ihr wahres menschenverachtendes Gesicht zeigten - siehe Herrscher wie Lenin, Stalin oder Mao, die mit ihren Regierungsformen zusammengenommen mehr als 100 Millionen Menschenleben nahmen oder den heutigen Machthaber der Volksrepublik China, der sein Volk innerhalb des Sozialkreditsystems zu bloße Zahlen objektivierte - weist die dogmatische Weltanschauung dennoch immer mehr Sympathisanten auf. Wie kann es sein, dass eine so realitätsferne Ideologie noch immer so viele Anhänger hat? Eine mögliche Ursache kann ein großangelegter Imagewechsel sein. Lange wurden sozialistische Ideen mit linksextremistischen Splittergruppen in Verbindung gebracht, die auf die breite Masse eher einen verschrobenen Eindruck machten.
Inzwischen gilt der Sozialismus in westlichen Gesellschaften eher als cool und zeitgemäß. Er ist zu einer Art “Hipsterphänomen” geworden, der jeden Verfechter bei oberflächlicher Betrachtung automatisch zum Gutmenschen macht. Nun wird von modernen Sozialisten immer wieder das Narrativ hervorgebracht, die Herrschaftsform wäre ja nur noch nie richtig umgesetzt worden. Was sie nun genau anders machen wollen, können sie jedoch nicht wirklich erläutern. Zwar berufen sie sich auf den demokratischen Sozialismus, der eine zentralisierte Bürokratie abgeschafft und stattdessen die Entscheidungsmacht der Arbeiterklasse übergeben hat, doch waren dies immer die Worte sozialistischer Machthaber kurz vor ihrem Amtsantritt. Und genau das ist der springende Punkt bei einem Imagewechsel. Die äußeren Merkmale mögen sich vielleicht verändert haben, doch die Kerninhalte bleiben dieselben: Eine gleichgeschaltete Lebenswelt, in der jegliche Individualität, Selbstverwirklichung und starke Persönlichkeiten
keinen Platz haben.
Alina Senger ist Publizistin und frühere Sozialarbeiterin in der Kinder- und Jugendhilfe aus Braunschweig.